Frage: Was für eine Auswahl an Filmen und Serien bietet Netflix?
Antwort: Bei Netflix gibt es Tausende Filme und Serien, die Sie sofort über Ihren Computer oder ein beliebiges streamingfähiges Gerät – wie PS3, Wii oder Xbox 360 – auf Ihrem Fernseher ansehen können. Sie können beliebig oft pausieren, vor- und zurückspulen oder immer wieder neu ansehen – natürlich alles ohne Werbung. Es ist wirklich so einfach.
Dieser kurze Auszug aus der FAQ zur deutschen Version von Netflix verdeutlicht buchstäblich, was mich an den Streaming-Anbietern stört: Deren Angebot geht für mich leider völlig am Problem vorbei. Auf eine absolut berechtigte und oft gestellte Frage, die man zum Beispiel leicht beantworten könnte, indem man die Liste der Filme und Serien eben NICHT vor den interessierten Besuchern verbirgt, wird bereits nach einem mageren halben Satz dummdreist am Thema vorbeigerudert. Oho, ich kann vor- und zurückspulen! Und pausieren! Ich kann mit einem Auge zusehen, oder mit beiden, ich kann sogar beide Augen schließen und nur den Ton hören – so viele Möglichkeiten bietet mir Netflix, die hier genauso gut über das schöne Wetter bei Netflix erzählen könnten. Wie zynisch die faule Antwort „Tausende Filme und Serien“ auf die Frage, welche AUSWAHL an Filmen und Serien ich dort für mein Geld bekomme, überhaupt ist, darüber müssen wir wohl kaum diskutieren. Netflix hat gar nicht die Absicht, die Frage zu beantworten.

Aber Netflix ist da in schlechter Gesellschaft. Wer erfahren will, ob ein bestimmter Film bei einem oder mehreren Streaming-Anbietern im Programm ist, der muss sich etwa auf den Drittanbieter-Service werstreamt.es verlassen, denn nur dort erfährt man tatsächlich, ob sich ein Abo überhaupt lohnt. Dass die Streaming-Anbieter ihr Angebot eigentlich nur den Leuten in vollem Umfang offenbaren, die bereits ein Abo abgeschlossen haben, ärgert mich schon sehr lange, denn das Angebot ist für mich entscheidend bei der Wahl des Anbieters, nicht umgekehrt.
Aber das ist noch gar nicht das Hauptproblem des Streamings. Viel schlimmer finde ich, dass oftmals bei den Filmen ein „Verfügbar bis“-Datum eingeblendet wird. Manchmal gibt es einen Staffel-Countdown, der die Tage herunterzählt, bis eine bestimmte Staffel einer Serie aus dem Angebot verschwindet. Dies sind furchtbare Auswüchse des ekligen Sumpfes an Verträgen, Verwertungsrechten und Exklusivrechten, die dafür sorgen, dass viele Filme und Serien nur zeitlich begrenzt im Angebot sind, und dann entfernt werden, wenn Verträge auslaufen. Tatsächlich befand ich mich mit Kollegen schon einmal genau in der lustigen Situation, dass wir über mehrere Tage hinweg eine Filmreihe über einen Streaming-Anbieter sehen wollten. Dummerweise verschwand die Filmreihe plötzlich wieder aus dem Filmsortiment, bevor wir am Ende angelangt waren. Die Begeisterung war groß. So ist Streaming. Genau so.
Über das DRM bei den legalen Streaming-Angeboten müsste ich als nächstes zu sprechen kommen. Dank Microsoft Silverlight etwa kann mir die Streaming-Software untersagen, Monitore an den PC anzuschließen, die kein HDCP unterstützen. Ein reiner VGA-Monitor und viele ältere DVI-Monitore dürfen erst gar nicht eingestöpselt sein, will man Filme mit DRM sehen, egal ob der Monitor dafür verwendet wird oder nicht. Auch kann die Unterstützung beispielsweise von Linux und/oder bestimmten Browsern durch die DRM-Maßnahmen nicht garantiert werden, auch wenn es am Streaming des Films selbst nie scheitern würde. Natürlich bezahlt der Kunde am Ende selbst die teuren DRM-Lösungen, auch wenn er davon gar nicht profitiert.
Als ich mir zur Entstehungszeit dieser Distributionstechnik Gedanken darüber machte, wofür man Streaming einsetzen könnte, da leuchteten mir die Augen: Die größte Film- und Serienbibliothek der Welt – jederzeit verfügbar – egal wo man sich befindet – egal welche Sprache man bevorzugt, egal ob Kinofassung oder der Directors Cut, natürlich alles ungeschnitten. Derrick auf japanisch, längst vergessene Stummfilme aus der Zeit des ersten Weltkriegs, skandalöse italienische Splatterfilme aus den 70ern, und natürlich alle aktuellen Blockbuster, und das immer nur wenige Mausklicks entfernt. Doch letztendlich wird es nichts davon sein. Streaming-Anbieter schießen wie Pilze aus dem Boden und wetteifern mit Geldscheinen winkend um die begehrten aktuellen Filme und Serien. Die alten, nicht so bekannten Filmerzeugnisse findet man dagegen weniger, Raritäten praktisch gar nicht, denn damit lässt sich auch kein Geld verdienen. Wer ein möglichst breites Spektrum abdecken will, von dem wird erwartet, Abonnements bei fünf verschiedenen Anbietern abzuschließen.
Viele meiner Lieblingsserien und -filme kann ich weder bei Netflix, Maxdome, Watchever, Amazon Prime, Lovefilm etc. finden. Schlimmer noch: Irgendein Netflix-Manager sagte erst vor kurzem, er sehe gar keinen Sinn darin, ein möglichst großes Angebot anzustreben. Er fände es gut, wenn sich weitere Streaming-Anbieter für Nischenbereiche entwickelten. Also soll ich mir in Zukunft für jedes Genre einen spezialisierten Anbieter suchen, die monatlich allesamt fünf bis zehn Euro bei mir abbuchen? Das wird definitiv nicht passieren. Ich verzichte auch weiterhin gerne auf das aus meiner Sicht eher schwache Angebot der etablierten Streamingdienste. Noch gibt es Blu-ray und DVD. Die verschwinden wenigstens nicht plötzlich aus meiner Sammlung, wenn irgendein dämlicher Vertrag gerade ausläuft.
Freilich bin ich ein sehr spezieller Nutzer. Netflix & Co. bedienen vor allem den Löwenanteil der Nutzer, die sich – analog zum Fernsehen – gerne von dem Angebot irgendwie berieseln lassen. Diese erwarten hauptsächlich, dass die neuesten Kinofilme und topaktuelle Serien dabei sind, mehr nicht. Diese Nutzer durchsuchen das vorgegebene Angebot, und entscheiden sich dabei spontan. Ich dagegen kenne bereits im Vorfeld die Filme und Serien, die ich schauen möchte, und diese finde ich dort zu meiner Enttäuschung oft nicht. Ich habe die Hoffnung allerdings noch nicht aufgegeben, dass diese allumfassende Film- und Serienbibliothek im Internet irgendwann doch noch entstehen wird, aber dazu müsste Netflix erst einmal in der Versenkung verschwinden, und dann müssten sich die Filmstudios endlich in sehr vielen Punkten einig werden. Im Moment bleibt diese Technik noch weit unter ihren Möglichkeiten. So interessiert mich das alles nicht.




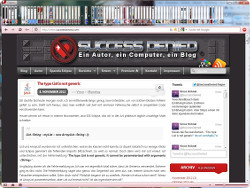
 Vor Wochen hat mir ein Kollege mit ausgeprägtem Bewusstsein für Privatsphäre im Netz die Metasuchmaschine startpage.com empfohlen. Diese macht nichts anderes als deine Suchanfragen an Google weiterzureichen, allerdings so, dass Google diese nicht mehr mit deinem Google-Konto verknüpfen kann. Startpage anonymisiert die Internetsuche endlich wieder, so wie das eigentlich sein sollte. Einziger Wermutstropfen: Die Bildersuche von startpage ist nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Google selbst liefert deutlich bessere Ergebnis. Doch längst habe ich Startpage zur Standardsuchmaschine in meinem Browser gemacht, und ich kann mich bislang nicht beschweren.
Vor Wochen hat mir ein Kollege mit ausgeprägtem Bewusstsein für Privatsphäre im Netz die Metasuchmaschine startpage.com empfohlen. Diese macht nichts anderes als deine Suchanfragen an Google weiterzureichen, allerdings so, dass Google diese nicht mehr mit deinem Google-Konto verknüpfen kann. Startpage anonymisiert die Internetsuche endlich wieder, so wie das eigentlich sein sollte. Einziger Wermutstropfen: Die Bildersuche von startpage ist nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Google selbst liefert deutlich bessere Ergebnis. Doch längst habe ich Startpage zur Standardsuchmaschine in meinem Browser gemacht, und ich kann mich bislang nicht beschweren.