 Vielleicht nicht DIE beste Serie, die ich mir je angesehen habe, aber es reicht locker für meine persönliche Top 3, würde ich sagen: Breaking Bad. Wen man auch fragt, jeder, der die Serie gesehen hat, spricht nur in den höchsten Tönen davon. Nachdem ich zuletzt mit Captain Future eine Reise in die Vergangenheit der Fernsehgeschichte gemacht habe, wollte ich wieder einen Blick in die Gegenwart wagen. Es hat sich nicht einfach nur gelohnt, es hat mich umgehauen. Es folgt ein kurzer Überblick über die Handlung und meine persönlichen Eindrücke, bei dem ich – wie immer – nur soviel über die Handlung vorwegnehme wie nötig, und so vage bleibe wie möglich. Aber die Spoilerwarnung möchte ich dennoch als ernstgemeint betrachtet wissen.
Vielleicht nicht DIE beste Serie, die ich mir je angesehen habe, aber es reicht locker für meine persönliche Top 3, würde ich sagen: Breaking Bad. Wen man auch fragt, jeder, der die Serie gesehen hat, spricht nur in den höchsten Tönen davon. Nachdem ich zuletzt mit Captain Future eine Reise in die Vergangenheit der Fernsehgeschichte gemacht habe, wollte ich wieder einen Blick in die Gegenwart wagen. Es hat sich nicht einfach nur gelohnt, es hat mich umgehauen. Es folgt ein kurzer Überblick über die Handlung und meine persönlichen Eindrücke, bei dem ich – wie immer – nur soviel über die Handlung vorwegnehme wie nötig, und so vage bleibe wie möglich. Aber die Spoilerwarnung möchte ich dennoch als ernstgemeint betrachtet wissen.
Breaking Bad ist die Geschichte über den (je nach Sichtweise) rasanten Aufstieg oder Absturz des Walter White, bzw. eigentlich mehr seinen Weg vom Regen in die Traufe, wobei Traufe vielleicht doch mehr so eine Art Sumpf ist, ein Drogensumpf vielleicht. Genau, also sein Weg vom Regen in den schlimmsten Drogensumpf, den man sich vorstellen kann. Der relativ erfolglose aber hochintelligente Chemielehrer Walter White lebt das Leben eines langweiligen, durchschnittlichen Amerikaners, mit einem kleinen Haus mit Pool, seiner schwangeren Ehefrau Skyler, seinem behinderten Sohn Walter jr. und einem Job, der irgendwie nie genug Geld einbringt, so dass er sein Gehalt mit einem Nebenjob aufstocken muss. Das wäre wohl alles noch zu ertragen gewesen, aber das Schicksal meint es nicht so gut mit ihm: Man diagnostiziert fortgeschrittenen Lungenkrebs bei ihm – inoperabel. Da hat sich das Nichtrauchen doch absolut gelohnt.
Walter hält seine Krankheit vor seiner Familie geheim, und beginnt gleichzeitig damit, sich Gedanken darüber zu machen, was nach seinem Tod aus seiner Familie wird, vor allem aus finanzieller Sicht. Als sein Schwager Hank Schrader, Agent bei der DEA (Drogenvollzugsbehörde), ihn zu einem kleinen Einsatz mitnimmt bei dem ein Drogenlabor ausgehoben werden soll, beobachtet Walter wie eine Person heimlich fliehen kann: sein ehemaliger Problemschüler Jesse Pinkman. Da er seiner Frau und seinen Kindern mit dem Waschen von Autos kaum rechtzeitig eine nennenswerte Menge Geld hinterlassen wird, beschließt er, seine Chemiekenntnisse einzusetzen, um in die Drogenherstellung einzusteigen. Er weiß was er riskiert, aber angesichts seiner äußerst schlechten Situation erscheint ihm seine Entscheidung als vertretbar. Er drängt Pinkman zu einer geschäftlichen Partnerschaft beim Kochen und Verkaufen der Designerdroge „Crystal Meth“.
 Womöglich hat er unterschätzt, WIE schmutzig das Drogengeschäft eigentlich ist, denn sein Traum vom gemütlichen Doppelleben als der begnadete Methamphetamin-Koch „Heisenberg“ zerplatzt relativ früh, schließlich müssen da Zeugen, Konkurrenten und unkooperative ehemalige Geschäftspartner beseitigt werden, bevor man selbst beseitigt wird. Walter muss sein Leben täglich ein bisschen mehr aufs Spiel setzen, seine selbstgesetzten moralischen Grenzen immer ein bisschen weiter überschreiten, damit seine zweifelhafte Karriere nicht auffliegt. Den Schein des spießigen, ahnungslosen Familienvaters zu wahren, fällt schon bald immer schwerer, und dadurch bekommt sein Lügengebilde die ersten großen Risse. Dass sein eigener Schwager bei der DEA auch noch ohne es zu ahnen dicht auf seiner Spur ist, macht Walters Alltag zwischen Chemotherapie, Auftragskillern, Familie und Drogendealern umso verzwickter.
Womöglich hat er unterschätzt, WIE schmutzig das Drogengeschäft eigentlich ist, denn sein Traum vom gemütlichen Doppelleben als der begnadete Methamphetamin-Koch „Heisenberg“ zerplatzt relativ früh, schließlich müssen da Zeugen, Konkurrenten und unkooperative ehemalige Geschäftspartner beseitigt werden, bevor man selbst beseitigt wird. Walter muss sein Leben täglich ein bisschen mehr aufs Spiel setzen, seine selbstgesetzten moralischen Grenzen immer ein bisschen weiter überschreiten, damit seine zweifelhafte Karriere nicht auffliegt. Den Schein des spießigen, ahnungslosen Familienvaters zu wahren, fällt schon bald immer schwerer, und dadurch bekommt sein Lügengebilde die ersten großen Risse. Dass sein eigener Schwager bei der DEA auch noch ohne es zu ahnen dicht auf seiner Spur ist, macht Walters Alltag zwischen Chemotherapie, Auftragskillern, Familie und Drogendealern umso verzwickter.
Breaking Bad ist extrem spannend und komplex, in der Hinsicht kann die Serie absolut etwa mit „24“ mithalten, die ich ebenfalls für außergewöhnlich halte. Wer aber allergisch gegen keifende Ehefrauen ist, wird so manche Episode nur schwer verdauen können. Nichts fand ich in der Serie so ekelhaft wie Skyler White. Kinder beschützen hier, Kinder in Gefahr da, sie will um jeden Preis die Löwenmutter spielen, scheitert aber kläglich daran. Stattdessen wirkt sie wie der letzte Hausdrache, eine herumbrüllende Geisteskranke, und noch dazu wie eine untreue, herzlose Furie. Zwischen all den schmierigen Drogenbossen und skrupellosen Killern ist Skyler die unsympathischste Figur in der Serie. Das hat sie sich wirklich verdient, und das musste mal gesagt werden.
Hauptdarsteller Bryan Cranston dürfte den Deutschen noch am ehesten als Vater aus der Serie „Malcolm Mittendrin“ bekannt sein, aber zwischen beiden Serien liegen Welten. Wer Breaking Bad bis jetzt noch nicht gesehen hat, sollte das schleunigst nachholen. Es lohnt sich. Die Charakterentwicklung ist beispiellos und auch bis ins letzte Detail glaubhaft. Soviele spannende Wendungen erlebt man selten. Cliffhanger werden sparsam eingesetzt, aber wirkungsvoll. Über das Finale verliere ich hier besser kein Wort, auch wenn man da noch das eine oder andere hätte sagen können. Als Zuschauer hat man irgendwann keine Ahnung mehr, für welche Figur man eigentlich mehr Verständnis haben sollte, und bekommt ein Lehrstück in fünf Staffeln darüber, dass, wer sich mit dem Bösen einlässt, irgendwann selbst dazugehört.


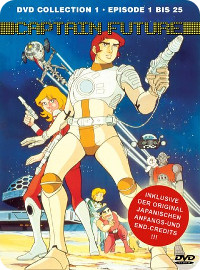 Erneut geht ein kleines Fernsehserienerlebnis in meinem Leben zuende, das mir einen kurzen abschließenden Kommentar wert ist. Dieses Mal wollte ich eine Serie aus meiner Kindheit wiederaufleben lassen. Von der japanischen Anime-Serie Captain Future sah ich als Kind nur vereinzelt ein paar Episoden, so dass mir nur sehr blasse Erinnerungen verblieben waren. Wieso also nicht einmal einen detaillierten Blick auf das Gesamtwerk werfen? Nunja, jetzt weiß ich warum. Manche Kindheitsgeschichten sollte man besser dort lassen wo sie hergekommen sind.
Erneut geht ein kleines Fernsehserienerlebnis in meinem Leben zuende, das mir einen kurzen abschließenden Kommentar wert ist. Dieses Mal wollte ich eine Serie aus meiner Kindheit wiederaufleben lassen. Von der japanischen Anime-Serie Captain Future sah ich als Kind nur vereinzelt ein paar Episoden, so dass mir nur sehr blasse Erinnerungen verblieben waren. Wieso also nicht einmal einen detaillierten Blick auf das Gesamtwerk werfen? Nunja, jetzt weiß ich warum. Manche Kindheitsgeschichten sollte man besser dort lassen wo sie hergekommen sind. Tatsächlich um Lichtjahre voraus war der tolle Synthi-Soundtrack von Schlagermusiker und ehemaligem GEMA-Jemanden-Abzocken-Aufsichtsrat Christian Bruhn. Wir hatten wirklich großes Glück, dass wir nicht das japanische Original-Intro aufgedrückt bekamen, denn dessen generischer schwermütiger Singsang passte überhaupt nicht zum Thema. Im Gegensatz zur etwas altbackenen Serie ist der deutsche Soundtrack absolut zeitlos. Phil Fuldner erkannte das Potenzial 1998, als er das fetzige Kampfthema der Serie zu dem Elektrohit „The Final“ verarbeitete.
Tatsächlich um Lichtjahre voraus war der tolle Synthi-Soundtrack von Schlagermusiker und ehemaligem GEMA-Jemanden-Abzocken-Aufsichtsrat Christian Bruhn. Wir hatten wirklich großes Glück, dass wir nicht das japanische Original-Intro aufgedrückt bekamen, denn dessen generischer schwermütiger Singsang passte überhaupt nicht zum Thema. Im Gegensatz zur etwas altbackenen Serie ist der deutsche Soundtrack absolut zeitlos. Phil Fuldner erkannte das Potenzial 1998, als er das fetzige Kampfthema der Serie zu dem Elektrohit „The Final“ verarbeitete. Es gibt nur wenige Pflichtfernsehserien für Menschen wie mich, die mit Begeisterung im IT-Bereich arbeiten. Eine davon ist „The IT Crowd“, habe ich mir sagen lassen. Die Serie wurde mir bereits 2008 im Original empfohlen, allerdings hatte ich damals zugegebenermaßen nur sehr wenig Ambitionen, mich in die hölzerne Welt der unterschiedlichen britischen Dialekte einzuhören. Im Jahr 2014 entschloss ich mich, der Serie zumindest in der deutschen Synchrofassung doch noch eine Chance zu geben. Originaltonnazis werden mich für diesen Satz nun auf dem Scheiterhaufen brennen sehen wollen, und auch im Freundeskreis wurde mir bereits versichert, dass ich mit dem deutschen Ton mindestens die Hälfte verpasse. Mindestens!
Es gibt nur wenige Pflichtfernsehserien für Menschen wie mich, die mit Begeisterung im IT-Bereich arbeiten. Eine davon ist „The IT Crowd“, habe ich mir sagen lassen. Die Serie wurde mir bereits 2008 im Original empfohlen, allerdings hatte ich damals zugegebenermaßen nur sehr wenig Ambitionen, mich in die hölzerne Welt der unterschiedlichen britischen Dialekte einzuhören. Im Jahr 2014 entschloss ich mich, der Serie zumindest in der deutschen Synchrofassung doch noch eine Chance zu geben. Originaltonnazis werden mich für diesen Satz nun auf dem Scheiterhaufen brennen sehen wollen, und auch im Freundeskreis wurde mir bereits versichert, dass ich mit dem deutschen Ton mindestens die Hälfte verpasse. Mindestens! Weitere erwähnenswerte Personen sind der klischeehafte aber freundliche Firmenchef Mr. Reynholm, der ungefähr zur Hälfte abgelöst wird durch seinen sexuell überdrehten Sohn Douglas, der ab da die Geschicke der Firma lenkt. Im dunklen Serverraum der IT-Abteilung haust der freundliche aber notorisch unglückliche Firmen-Goth und „Cradle of Filth“-Fan Richmond, der alleine durch sein Auftreten die Stimmung aller seiner Mitmenschen auf den Boden zieht, und daher die meiste Zeit in seinem kleinen Raum bleiben muss. Mit seiner wirklich überschaubaren Menge an Charakteren ist The IT Crowd ein schöner Kontrast zu Firefly. Den größten Wiedererkennungswert für die Serie wird Moss mit seinem einzigartigen Dreiviertel-Afro haben. Da verwundert es auch nicht, dass man für einen geplanten aber verworfenen US-Ableger der Serie alle Schauspieler ausgewechselt hat – bis auf Richard Ayoade.
Weitere erwähnenswerte Personen sind der klischeehafte aber freundliche Firmenchef Mr. Reynholm, der ungefähr zur Hälfte abgelöst wird durch seinen sexuell überdrehten Sohn Douglas, der ab da die Geschicke der Firma lenkt. Im dunklen Serverraum der IT-Abteilung haust der freundliche aber notorisch unglückliche Firmen-Goth und „Cradle of Filth“-Fan Richmond, der alleine durch sein Auftreten die Stimmung aller seiner Mitmenschen auf den Boden zieht, und daher die meiste Zeit in seinem kleinen Raum bleiben muss. Mit seiner wirklich überschaubaren Menge an Charakteren ist The IT Crowd ein schöner Kontrast zu Firefly. Den größten Wiedererkennungswert für die Serie wird Moss mit seinem einzigartigen Dreiviertel-Afro haben. Da verwundert es auch nicht, dass man für einen geplanten aber verworfenen US-Ableger der Serie alle Schauspieler ausgewechselt hat – bis auf Richard Ayoade. Der Nachteil, wenn man sich eine Serie mit nur wenigen Staffeln vornimmt: Man ist unverschämt schnell durch. Firefly ist da ein besonders schwerer Fall mit seinen 14 Episoden, die zwischen 2002 und 2003 gedreht wurden. Ich habe mir diese eine kümmerliche halbe Staffel wirklich streng rationiert, aber länger als vier Wochen haben die Vorräte leider nicht gehalten. Nun muss ich mir wieder eine neue Serie suchen, am besten eine mit zehn Staffeln, besser 20. Achtung, Spoiler voraus!
Der Nachteil, wenn man sich eine Serie mit nur wenigen Staffeln vornimmt: Man ist unverschämt schnell durch. Firefly ist da ein besonders schwerer Fall mit seinen 14 Episoden, die zwischen 2002 und 2003 gedreht wurden. Ich habe mir diese eine kümmerliche halbe Staffel wirklich streng rationiert, aber länger als vier Wochen haben die Vorräte leider nicht gehalten. Nun muss ich mir wieder eine neue Serie suchen, am besten eine mit zehn Staffeln, besser 20. Achtung, Spoiler voraus! Angesichts der vor allem heutzutage exotischen Genrekombination Sci-Fi mit Western ist das sehr hohe IMDb-Rating von derzeit 9,1 umso verwunderlicher, aber absolut gerechtfertigt. Firefly hatte ein solches Potenzial, und es ist wirklich schade, dass man dieses erst nach seiner Absetzung entdeckt hat. Vor allem von dem ausdrucksstarken Serienstar Nathan Fillion, den ich bereits als Bösewicht aus Buffy und aus „Two Guys and a Girl“ kenne, würde ich gerne mehr Hauptrollen sehen. Manches Mal stelle ich ihn mir fast als eine Art Captain(!) Jack Sparrow auf der Serenity vor, nur nicht ganz so exzentrisch. Könnte natürlich auch an der Synchronstimme von Johnny Depp liegen.
Angesichts der vor allem heutzutage exotischen Genrekombination Sci-Fi mit Western ist das sehr hohe IMDb-Rating von derzeit 9,1 umso verwunderlicher, aber absolut gerechtfertigt. Firefly hatte ein solches Potenzial, und es ist wirklich schade, dass man dieses erst nach seiner Absetzung entdeckt hat. Vor allem von dem ausdrucksstarken Serienstar Nathan Fillion, den ich bereits als Bösewicht aus Buffy und aus „Two Guys and a Girl“ kenne, würde ich gerne mehr Hauptrollen sehen. Manches Mal stelle ich ihn mir fast als eine Art Captain(!) Jack Sparrow auf der Serenity vor, nur nicht ganz so exzentrisch. Könnte natürlich auch an der Synchronstimme von Johnny Depp liegen.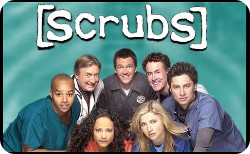 Erinnert sich noch wer an „Biing!“ und „Theme Hospital“? Beides leider nicht besonders bekannte Krankenhaussimulationen, aber beide gehen das eigentlich sehr ernste Thema Krankheit bzw. Krankenhaus auf eine sehr humoristische Weise an. Während es in Bullfrogs Aufbauspiel, wie der Name schon sagt, um den Aufbau, also die räumliche Komponente ging, war Biing! eine reinrassige Wirtschaftssimulation, in der man sich hauptsächlich mit den Finanzen beschäftigte – und mit den heißen Krankenschwestern.
Erinnert sich noch wer an „Biing!“ und „Theme Hospital“? Beides leider nicht besonders bekannte Krankenhaussimulationen, aber beide gehen das eigentlich sehr ernste Thema Krankheit bzw. Krankenhaus auf eine sehr humoristische Weise an. Während es in Bullfrogs Aufbauspiel, wie der Name schon sagt, um den Aufbau, also die räumliche Komponente ging, war Biing! eine reinrassige Wirtschaftssimulation, in der man sich hauptsächlich mit den Finanzen beschäftigte – und mit den heißen Krankenschwestern. Die drei Hauptcharaktere sind John „J.D.“ Dorian und sein bester Freund Chris Turk, sowie Elliot Reid, die gemeinsam ihr Medizinstudium abgeschlossen haben und als Assistenzärzte in besagtem Krankenhaus ihre Medizinerkarriere beginnen. Unterstützt (oder behindert) werden sie dabei von der Krankenschwester Carla Espinosa, Chefarzt Dr. Kelso und dem soziopathischen Stationsarzt Dr. Cox. Bereits früh in der Serie zeichnen sich die viel zu offensichtlichen Charakterpairings J.D.-Elliot und Turk-Carla ab. Während letztere quasi die ganze Serie hindurch zusammen sind, entwickeln J.D. und Elliot eine ermüdende On-Off-Beziehung, die schwer nachvollziehbar ist, da J.D. sich in jeder Hinsicht als beziehungsunfähig erweist, weil er nur haben will, was er im Moment nicht haben kann.
Die drei Hauptcharaktere sind John „J.D.“ Dorian und sein bester Freund Chris Turk, sowie Elliot Reid, die gemeinsam ihr Medizinstudium abgeschlossen haben und als Assistenzärzte in besagtem Krankenhaus ihre Medizinerkarriere beginnen. Unterstützt (oder behindert) werden sie dabei von der Krankenschwester Carla Espinosa, Chefarzt Dr. Kelso und dem soziopathischen Stationsarzt Dr. Cox. Bereits früh in der Serie zeichnen sich die viel zu offensichtlichen Charakterpairings J.D.-Elliot und Turk-Carla ab. Während letztere quasi die ganze Serie hindurch zusammen sind, entwickeln J.D. und Elliot eine ermüdende On-Off-Beziehung, die schwer nachvollziehbar ist, da J.D. sich in jeder Hinsicht als beziehungsunfähig erweist, weil er nur haben will, was er im Moment nicht haben kann.